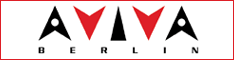Als der Düsseldorfer Droste-Verlag den „Ehrenmord“-Krimi von Gabriele Brinkmann plötzlich nicht mehr wollte, witterte der Leda-Verlag in Leer eine Zensurmaßnahme und veröffentlichte das Werk kurzentschlossen. Malte S. Sembten hat es für Lizas Welt gelesen.VON MALTE S. SEMBTEN
Als der Düsseldorfer Droste-Verlag den „Ehrenmord“-Krimi von Gabriele Brinkmann plötzlich nicht mehr wollte, witterte der Leda-Verlag in Leer eine Zensurmaßnahme und veröffentlichte das Werk kurzentschlossen. Malte S. Sembten hat es für Lizas Welt gelesen.VON MALTE S. SEMBTENEinst lebten Kriminelle gefährlich. Inzwischen leben Krimischreiber gefährlicher. Das gilt nicht etwa für Henning Mankell,
der zwar den Israelis öffentlich den kollektiven Selbstmord empfahl, um den Arabern ihre kollektive Ermordung zu ersparen, aber dennoch keine Todesdrohungen mordwütiger Zionisten erhielt. (Stattdessen sahnte er „für seine engagierte Schilderung des Lebens in Afrika“ den Erich-Maria-Remarque-Friedenspreis ab, der für genau das gleiche Verdienst auch
Leni Riefenstahl zu Lebzeiten hätte zuerkannt werden können.) Vielmehr wird die Aufmerksamkeit unfriedlicher Zeitgenossen der Bochumer Schriftstellerin Gabriele Brinkmann (Foto) zuteil. Nach dem Presserummel um den Verlagswechsel ihres Kriminalromans
Ehre, wem Ehre... landete ihr Name auf einer radikalislamischen Internetseite: Muslime, die ihr Buch nie in der Hand hielten und die ohne den öffentlichkeitswirksamen Rückzieher des ursprünglichen Verlegers niemals von den angeblich darin enthaltenen islamophoben Sakrilegien erfahren hätten, drohen der Autorin und anderen vermeintlichen „Islamhetzern“ mit dem Schwert von
„Abu Askar aus Deutschland“. Diese unlängst in einem Djihadistenvideo präsentierte eindrucksvolle Klinge rief im gesamten Abendland Neid hervor, führte aber auch zur Vermutung, es handle sich um ein Schinkenmesser-Requisit aus der Küche des Films
The Incredible Shrinking Man.
Doch mögen Abu Askar und die übrigen wichtighuberischen Butzemänner aus den Trainingslagern der Islam-Terroristen auf
Youtube auch noch so erheiternd rüberkommen – für die betroffene Autorin dürfte sich der Spaß dabei in Grenzen halten. Wahrscheinlich ist immerhin, dass das kaufmännische Kalkül ihres neuen Verlags, die skandalbedingte überregionale Aufmerksamkeit für den regionalen Krimi werde sich in erhöhtem Bücherabsatz niederschlagen, aufgeht. Sicher ist (dem neuen Verlag sei Dank), dass bereits ein Etappensieger aus der beherzten Romanveröffentlichung hervorging: die Freiheit des Wortes. Schon darum (und weil ein Teil des Erlöses an
Solwodi – Solidarität mit Frauen in Not geht) lohnt der Kauf des Buches. Doch lohnt auch die Lektüre?
Ansatzpunkt der Krimihandlung ist ein Drive-by-Shooting in der Bochumer Innenstadt. Aus einem Auto heraus wird auf eine türkische Metzgerei gefeuert. Ein Angestellter des Ladens und eine deutsche Passantin sterben sofort. Eine junge Türkin erliegt ihren Verletzungen auf der Intensivstation. Die Kripo vermutet eine ausländerfeindlichen Neonazi-Anschlag oder einen Krieg zwischen rivalisierenden Kiezkönigen. Verfolgt wird schließlich die vermutete Spur zum russischen Bordellboss. Nur die leitende Kommissarin Thea Zinck ermittelt eigenmächtig in eine politisch unbequeme Richtung. Sie tippt von Anfang an auf einen türkischen ,Ehrenmord‘.
Gleich auf der ersten Seite erweist Gabriele Brinkmann sich als zünftige Krimischreiberin. Ihre Kommissarin führt nämlich die Dienstwaffe im „Holster“ und nicht, wie man bei deutschsprachigen Autoren und Übersetzern häufig liest, im „Halfter“, so, als ginge es um Hufeisenträger statt um Schießeisenträger. Die Trunksucht der daueralkoholisierten Kommissarin lässt auf klassische Genre-Vorbilder schließen. Nein, gemeint sind nicht die
Alkis vom ZDF-Kriminaldauerdienst und auch nicht die
Psychos mit Dienstausweis vom ARD-Tatort, obwohl gewisse Parallelen nicht von der Hand zu weisen sind.
Vielmehr ist Thea Zinck eine späte und degenerierte Nachfahrin der Privatdetektive aus der amerikanischen Hardboiled-Schule. Zwar weiß sie die Faust nicht zu gebrauchen wie Phil Marlowe, doch wie er verwahrt sie „Notfall-Flachmänner“ in der Schublade ihres Büroschreibtischs und im Handschuhfach ihres Automobils. Anders als Marlowe setzt sie auf Wodka statt auf Whiskey, und im Gegensatz zu ihm bedingt ihr stabil hoher Blutalkoholpegel chronische Ausfallerscheinungen, sodass sie nach erfolgtem Führerscheinentzug ihr Auto nicht mehr selbst steuern darf. Dass sie dennoch von allen Angehörigen der Bochumer Mordkommission die „höchste Quote“ hat, also die höchste Verbrechens-Aufklärungsrate beanspruchen darf, dient als Begründung für die schier unfassbaren Freiheiten, die sie sich während der Dienstausübung und speziell gegenüber ihrem Vorgesetzten Abels herausnehmen kann. Gleichzeitig gemahnt es uns daran, dass uninspirierte Bürokraten und Technokraten niemals Säufer sind, sensible Künstler und andere an der Menschheit leidende Genies hingegen oft.
Um dieses torkelnde Zentralgestirn gruppiert sich weiteres Romanpersonal aus dem Bochumer Polizeipräsidium. Auf der engsten Umlaufbahn kreist Zincks neuer Kriminalassistent Kai Stettner. Wie es spätestens seit Holmes und Watson altbewährter Krimibrauch ist, gibt er als „Sidekick“ das Kontrastbild zur Hauptfigur. Wo Zinck rabiat und rücksichtslos ist, ist er furchtsam und sanft. Wo sie konfrontativ ist, ist er konziliant. Sie glaubt an das Böse, er glaubt an das Gute. Geschmäht als „Helferlein“ der unbeliebten Zinck und verachtet wegen vermeintlicher erwiesener Feigheit, wird Stettner zum Prügelknaben seiner neuen ,Kollegen‘. Dabei erinnern deren Mobbing-Methoden an die brutalen Initiationsriten amerikanischer Studentenverbindungen oder sadistische Erniedrigungsrituale unter Internatsschülern. Ist so etwas an einem deutschen Polizeipräsidium überhaupt denkbar? Vor wenigen Monaten jährten sich nacheinander die
Selbstmorde dreier junger, deutscher, von ihren Revierkollegen drangsalierter Polizistinnen zum zehnten Mal. Somit fällt ein überzeugtes ,Nein‘ als Antwort schwer.
Hauptmotor der Feindseligkeiten gegen Stettner ist Horst Schreiber, fett, verschlagen, brutal und feige, das Ekel vom Dienst der Bochumer Mordkommission. Zur unvermeidlichen personellen Konstellation gehören außerdem der Deutsch-Türke vom Dienst, Lothar Özgü, Lieferant interkultureller Kompetenz, sowie Dr. Manfred Abels, der sich schon mittels Doktortitel und Krawatte als der typische selbstgefällige, karrieristische, rückgratlose Vorgesetzte der Beamtenschar outet. Für ihn ist der Mehrfachmord kein Kriminalfall, den es aufzuklären gilt, sondern ein Störfall, der politisch möglichst schmerzlos ad acta gelegt werden muss.
Nebst derlei Figuren erfindet die Autorin Dialoge, die zumindest anfänglich oft hölzern oder abgedroschen ausfallen (Was hält der RTL-Reporter dem zugeknöpften Kripochef entgegen? „Die Bürger haben ein Recht auf Information!“), jedoch im Verlauf flüssiger werden und manchmal sogar Filmreife besitzen (Kotzbrocken Schreiber zu Zincks Ex-Assi Özgü: „Du hast ja auch mal unter der Domina gedient. Was macht die eigentlich mit euch? Beißt die euch gleich am ersten Tag die Pimmel ab und legt die in Wodka ein?“).
Insofern würde alles perfekt zu einem öffentlich-rechtlichen Primetime-Krimiabend passen. Daher überrascht es nicht, dass die Story, ehe sie zur Romanform fand, als Filmstoff bei einem Drehbuchwettbewerb zum neudeutsch benannten Thema „Clash der Kulturen“ eingereicht wurde. Dass sie es nicht auf die Mattscheibe schaffte, überrascht ebenso wenig – und es liegt nicht an Mängeln der Vorlage, sondern an der mangelnden Courage der Produzenten.
Das Gegensatzpaar Thea Zinck/Kai Stettner personifiziert nämlich ohne politisch korrekte Zurückhaltung den Kontrast ,Islam- und Türkenfeind‘ auf der einen und ,ahnungsloser Gutmensch‘ auf der anderen Seite. Vermutlich würden Verlag und Autorin diesen ,Vorwurf‘ gegen ihre Kommissarin zurückweisen. Doch Tatsache ist, dass Stettner bestürzt und erschrocken erkennt, dass seine neue Vorgesetzte ein lückenloses Kompendium aller gängigen Vorurteile (oder – je nach Standpunkt – begründeten Vorbehalte) gegen den Islam und türkische Einwanderer verkörpert; auch und gerade in Bezug auf die Frauenrolle im Islam und im türkischen Patriarchat. Aber nicht nur im Denken, sondern auch in Rede und Auftritt stellt Thea Zinck geradezu die Inkarnation politischer Unkorrektheit dar.
Zugleich repräsentiert diese anstößige und respektlose Kommissarin und Anti-Multikulturalistin die Stimme, mit der die Autorin selbst spricht. Das merkt der Leser früh. Dieser Kriminalroman will keine Detektivgeschichte, kein ,Whodunnit‘ sein, und so ist nicht zu viel verraten, wenn man vorweg nimmt, dass die von Zinck schon früh verdächtigte türkische Familie den Mord an der eigenen Tochter bzw. der eigenen Schwester tatsächlich begangen hat, und dass es sich tatsächlich um einen so genannten ,Ehrenmord‘ handelt.
Die einzelnen Mitglieder der Ehrenmord-Familie Cetin selbst sind – je nach Sichtweise – Klischeefiguren oder beispielhafte Prototypen eines bestimmten Schlages muslimisch-türkischer Zuwanderer. Die Familie besteht auf Täter- und Mitverschwörerseite (man könnte auch sagen, auf männlicher Seite) aus den folgenden Personen: dem Vater, der – ebenso wie seine fast unsichtbar bleibende Frau – auch nach jahrzehntelangem Aufenthalt in Deutschland kaum ein Wort Deutsch spricht; aus dem Onkel, dem „Mullah“, der Deutsch radebrecht und als Clanoberhaupt fungiert; schließlich aus den drei Söhnen. Alle drei scheinen vordergründig bestens integriert: Tayfun Cetin, der älteste Bruder, des Deutschen perfekt mächtig, wortgewandt und smart, leitet die Filiale eines Autohauses. Hakan, der Zweitgeborene, spricht ebenfalls ein makelloses Deutsch und besitzt eine Diskothek. Bekir, der jüngste Spross, auch er ohne Defizite im Deutschen, absolviert eine Banklehre.
Gleichzeitig sind alle drei stark in der muslimischen Kultur und in ihren heimatlichen Traditionen verhaftet; die scheinbare Adaption an die Lebensart des Aufnahmelandes erweist sich als ein dünn aufgetragener Lack. Tayfun misshandelt seine Frau und betrügt sie mit einer deutschen „Hure“. Zusammen mit Hakan verübt Tayfun das Metzgerei-Massaker. ,Kollateralschäden‘, ob toter türkischer Ladengehilfe oder tote deutsche Frau, belasten das Gewissen zumindest der beiden älteren Brüder anscheinend wenig. Mit dem Blut bereits dreier Menschen an den Händen prügeln Tayfun und Hakan später noch den deutschen Freund ihrer ermordeten Schwester zu Tode. Nur Bekir, der Jüngste, scheint von Skrupeln geplagt. Als Hobby betreibt das Brüder-Trio Kampfsport in einem türkischen Kickbox-Club.
Auf der Opferseite der Cetins stehen: Yasemin, die einzige Tochter; Leyla, Tayfuns Frau; schließlich Atila, deren Sohn. Die ,Todsünden‘ gegen die Familienehre, deren Yasemin sich schuldig macht: Sie verliebt sich auf der Abendschule in einen Deutschen. Sie verbündet sich heimlich mit Leyla gegen ihren gewalttätigen Gemahl. Sie versucht, ihrer ins Frauenhaus geflohenen Schwägerin Leyla den kleinen Atila zuzuführen.
Bei den Ermittlungen in diesem Umfeld erlebt Kriminalassistent Stettner, dass seine naive gutmenschliche Einstellung schmerzlich auf die Probe gestellt wird. Ihm (und dem Leser) wird die geballte Parallelwelt-Ladung verabreicht – fast kein ,Standard-Aspekt‘ fehlt: Deutsche Frauen fallen auf muslimische Machos rein und zahlen in harter Währung Lehrgeld... Muslime praktizieren ,Taqquyia‘ (ein religiös legitimiertes Belügen von ,Ungläubigen‘)... Muslimische Mädchen haben Analsex, um ihr Jungfernhäutchen intakt zu halten... Muslime spielen ständig und erpresserisch die „Rassismus-Karte“... Muslimische Immigranten verweigern der deutschen Polizei die zivile Mithilfe bei Ermittlungen in ihren eigenen Milieus; wenn in ihren Milieus Festnahmen erfolgen, rotten Muslime sich drohend gegen die Beamten zusammen... Özgü, der Deutsch-Türke, der loyal das deutsche Gesetz vertritt, wird in bestimmten Türkenkreisen als Verräter verachtet. Und so weiter, und so fort.
Selbstverständlich gibt es im Sinne des Ausgleichs und um den Einruck vorurteilsvoller Einseitigkeit zu vermeiden zwei Versöhnlichkeitscharaktere, die als Gegenbeispiel dienen. Dies sind Sevgi, Stettners Friseurin, das Musterbild einer modernen, ,in Deutschland angekommenen‘ jungen Türkin, und natürlich Lothar Özgü, der ruhige, zurückhaltende Kriminalpolizist mit der deutschen Mutter und dem türkischen Vater. Ein Sympathieträger unter den Nebenfiguren, der mit Zincks Einstellung oftmals Schwierigkeiten hat. Man ahnt, warum er trotz ihres gegenseitigen Respekts der
ehemalige Assistent der Kommissarin ist.
In Zincks Charakter indessen wird ein sonderbarer Bruch offensichtlich: So rigoros sie ihr anstößiges Alltagsgebaren und ihre offensiven Überzeugungen in Bezug auf Muslime und speziell die muslimische Frauenfeindlichkeit pflegt, so elastisch ist der Maßstab, den sie an die Frauenverachtung eines Bordelliers anlegt. Slawa, der russische Kiezkönig und Puff-Pate, der bei der Kripo als Auftraggeber des Metzgerei-Massakers in Verdacht steht, ist schon seit Langem ihr Saufkumpan. Regelmäßig lässt sie sich von ihm im Privatseparee seines Etablissements unter den Tisch bechern. Dass er sich in seinem Reich nicht gerade als Frauenversteher geriert, perlt an ihr ab:
[Zinck:] „Dein Frauenbild ist zum Kotzen, grundsätzlich. Wenn das einer mit deinen Töchtern machen würde...?“
[Slawa:] „Wäre er morgen tot.“ Er deutete mit dem Kopf auf Grischa und Sascha, die am anderen Ende des Tresens saßen. „Hm... nein, am selben Tag, fürchte ich.“
Die Kommissarin kippte ihren Wodka herunter. „Und was würdest du mit deinen Töchtern machen?“
„Ich nehme ihnen die Kreditkarten weg.“ Er hob sein Glas. „Prost, Thea. Auf die Frauen.“
Die beiden stießen miteinander an und leerten ihre Gläser.
Durch den Boden eines Wodkaglases betrachtet, entfalten Chauvinismus und Frauenverachtung urplötzlich einen rauen Charme. Zu allem Überfluss dichtet die Romanverfasserin dem Russenboss und seinen Handlangern im Laufe des Geschehens eine kitschige Gangster-Ehre an. Falls diese den romantischen Kontrast zur perversen Familien-Ehre der Cetins abgeben soll, wäre das nicht nur falsch, sondern verlogen.
Was immer diese Kiezrussen an der Kommissarin finden, bleibt als Frage offen. Um ihnen geschäftlich zu nutzen, ist Zinck nicht korrupt genug. Dennoch hat „Madame Thea“, wie sie von Slawas Gorilla-/Schläger-/Killer-Gespann respekt- und zuneigungsvoll genannt wird, bei Slawa und den beiden Jungs einen dicken Stein im Brett. Dass zwei Typen dieses Kalibers eine alkoholkranke deutsche Polizistin Mitte fünfzig – die sie nach jeder Saufniederlage im Bordell als stinkendes, wankendes und lallendes Wrack nach Hause bringen und oft auch noch ins Bett verfrachten müssen – hochachten und in ihre großen russischen Herzen schließen, lässt sich schwer glauben. Aber die russische Seele ist ja bekanntermaßen unergründlich.
Ein zweiter hervorgehobener Kritikpunkt betrifft Zincks Assistenten Kai Stettner. Als einziger Polizist des Romans gewährt er dem Leser eine gewisse Anteilnahme an seinem Privatleben, was darauf schließen lässt, dass Stettner die eigentliche Sympathie- und Identifikationsgestalt des Romans darstellen soll. Dummerweise hat das offenbarte Privatproblem Stettners – ein demenzkranker Vater, der in seinem Heim nicht zurechtkommt – nichts mit der Romanhandlung oder Stettners Charakterentwicklung zu tun, außer dass Stettner dadurch von der Ermittlungsarbeit abgelenkt wird. Diese Romanabschnitte sind schlicht überflüssig.
Es dauert einige Seiten, bis der Roman stilistisch in Fluss kommt, dann jedoch erweist die Autorin sich als souveräne Erzählerin. Die Lesespannung hält trotz der Vorhersehbarkeit bis zum Ende an.
Apropos: Der Gutachter des Landeskriminalamts, bei dem der ursprüngliche Verleger in seiner Gewissensnot um Rat ersuchte, legt, wie die Autorin zu berichten weiß, in seiner Expertise dem „kritischen Leser“ die „sorgfältige Lektüre bis zum Schluss des Buches“ nahe, auch weil das Ende „so sehr aufwühlend“ sei. Tatsächlich: Der letzte Absatz der Geschichte trifft den Leser wie ein Schuss, der sich aus einer noch rauchenden, aber bereits gesicherten Pistole löst.
Das ist dann abermals filmreif.
W. W. Domsky: Ehre, wem Ehre... Taschenbuch, 253 Seiten, 9,90 Euro. Leda-Verlag, Leer 2009. ISBN 978-3-939689-33-1
Foto: © privat